Unerfüllter Kinderwunsch & Psychotherapie – Unterstützung und emotionale Begleitung

Unerfüllter Kinderwunsch und Psychotherapie: Wenn Sehnsucht zur Belastung wird – Julia Benner Der Kinderwunsch ist selten nur ein Plan. Für viele Menschen ist er ein Gefühl, ein Lebensentwurf, ein Stück Identität. Wer sich ein Kind wünscht, sehnt sich nach Nähe, Verbundenheit und Sinn. Wenn dieser Wunsch sich nicht erfüllt, kann das ganze Leben ins Wanken geraten. Plötzlich scheint es, als würden alle anderen schwanger werden, während man selbst auf der Stelle tritt. Familienfeste werden zur Herausforderung, beiläufige Fragen wie „Und wann ist es bei euch so weit?“ zu kleinen Stichen, die tief treffen. In Deutschland betrifft das Thema rund jedes zehnte Paar (Wischmann, 2024). Trotzdem wird es häufig verschwiegen. Scham, Schuldgefühle und die Angst, auf Unverständnis zu stoßen, sorgen dafür, dass viele Betroffene ihre Verzweiflung im Stillen tragen. Dabei ist gerade dieses Schweigen Teil der Last. In den vergangenen Jahren hat sich jedoch etwas verändert: Immer mehr Menschen, darunter auch bekannte Persönlichkeiten und Influencer:innen, sprechen offen über ihre Kinderwunschreise, über Hormonbehandlungen, Fehlversuche, Fehlgeburten und darüber, was diese Zeit seelisch mit ihnen macht. Diese Offenheit schafft Verbundenheit, sie nimmt dem Thema das Stigma und ermutigt andere, Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Psychotherapie kann ein solcher Ort sein : ein Raum, in dem man sich nicht erklären oder rechtfertigen muss. Sehnsucht als unterschätzte Belastung Ein unerfüllter Kinderwunsch ist mehr als eine medizinische Herausforderung. Er kann das emotionale Gleichgewicht zutiefst erschüttern. Viele Betroffene beschreiben die Zeit als ein ständiges Auf und Ab zwischen Hoffnung und Enttäuschung, begleitet von der Angst, dass der eigene Körper versagt. Manche erleben die Monate in Zyklen, in denen jede Blutung zum Symbol für das, was nicht gelungen ist, wird. Und jede neue Behandlung wird zur Projektionsfläche für Hoffnung, jeder negative Test zu einem kleinen Zusammenbruch. Es ist ein Kreislauf aus Warten, Hoffen, Bangen und Loslassen und in jedem Zyklus liegt ein Moment des Abschieds. Diese wiederkehrende Trauer ist besonders schwer, weil sie keinen sichtbaren Ausdruck hat. Es gibt kein Ritual, kein offizielles Ende, keine gesellschaftliche Sprache für diesen Verlust. Und doch ist er real. Manche Betroffene erzählen, dass sie sich nach jeder erfolglosen Behandlung innerlich verabschieden müssen, z.B. von einem vielleicht schon geahnten Leben, einem Bild, das für einen kurzen Moment existiert hat. Psychologisch betrachtet handelt es sich um eine kumulative Trauer, die sich über Monate und Jahre aufbauen kann. Studien wie jene von Thanscheidt et al. (2023) zeigen, dass diese Form der emotionalen Dauerbelastung nicht nur zu Erschöpfung, sondern auch zu depressiven Symptomen führen kann. Sie zeigen, dass sowohl Frauen als auch Männer psychisch stark belastet sind. Auch Partnerschaften geraten in Mitleidenschaft. Nicht selten fühlen sich beide Seiten unverstanden und emotional voneinander entfernt, obwohl sie dasselbe Ziel haben. Solche Erfahrungen sind keine Schwäche. Sie sind Ausdruck eines tiefen seelischen Konflikts, in dem sich Hoffnung, Verlust und Selbstzweifel überlagern. Häufig berichten Betroffene: „Ich erkenne mich selbst nicht wieder – mein Leben dreht sich nur noch um den Kinderwunsch.“ „Jedes Mal, wenn eine Freundin schwanger wird, habe ich das Gefühl, versagt zu haben.“ „Wir streiten uns mehr, obwohl wir eigentlich dasselbe wollen.“ Diese Aussagen zeigen, wie sehr unerfüllter Kinderwunsch auch u.a. das Selbstwertgefühl und die Beziehung erschüttern kann. Eine Seele, die leidet und wie Psychotherapie hilft Psychotherapie bietet die Möglichkeit, Worte für das zu finden, was sonst unausgesprochen bleibt. Sie hilft, das emotionale Chaos zu sortieren und einen Umgang mit Gefühlen zu entwickeln, die zunächst überwältigend erscheinen. Sie hilft Trauer zu erkennen, anzunehmen und zu verarbeiten. Sie schafft einen Raum, in dem Hoffnung und Schmerz nebeneinander existieren dürfen. Wer sich erlaubt zu trauern, entlastet nicht nur die Seele, sondern auch den Körper. Denn unausgesprochene Gefühle binden enorme Energie und verstärken Stress .Eine große Meta-Analyse von Kremer, Ditzen und Wischmann (2023) belegt, dass psychologische Unterstützung die seelische Belastung bei unerfülltem Kinderwunsch deutlich reduzieren und den Verlauf medizinischer Behandlungen positiv beeinflussen kann. Paare, die begleitet werden, brechen seltener ab und empfinden die Zeit der Behandlung als weniger zermürbend. In der Psychotherapie geht es darum, wieder in Kontakt mit den eigenen Bedürfnissen und Grenzen zu kommen, belastende Gedanken zu erkennen und zu verändern, Gefühle zu regulieren und Selbstfürsorge zu entwickeln. Wenn Paare sich entfremdet haben, kann eine gemeinsame paartherapeutische Begleitung helfen, die gegenseitige Perspektive zu verstehen und wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Eine stabile emotionale Verfassung ist nicht nur psychisch entlastend, sondern auch physiologisch bedeutsam. Chronischer Stress und anhaltende innere Anspannung wirken sich negativ auf hormonelle Prozesse aus. Wenn Menschen lernen, mit Enttäuschungen, Ängsten und Scham anders umzugehen, entsteht ein inneres Milieu, das den Körper entlastet und günstige Bedingungen für eine mögliche Empfängnis schafft. Studien zeigen, dass ein ausgeglichener emotionaler Zustand und ein reduziertes Stressniveau mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für erfolgreiche reproduktionsmedizinische Behandlungen einhergehen. Die Verhaltenstherapie hat sich in diesem Bereich besonders bewährt. Sie ist wissenschaftlich fundiert und zugleich praxisnah. Gemeinsam werden konkrete Bewältigungsstrategien entwickelt, die helfen, mit den emotionalen Höhen und Tiefen umzugehen. Eine Patientin, die ich einige Zeit begleitet habe, hatte bereits mehrere erfolglose Behandlungszyklen hinter sich. Selbst die Kinderwunschklinik wusste keinen neuen Ansatz mehr und empfahl eine psychotherapeutische Unterstützung. Nach einer Fehlgeburt war die Hoffnung fast erloschen. Die Frau hatte Angst vor Familienfeiern, Angst vor einem erneuten Versuch, aber auch Angst davor, den großen Wunsch loszulassen. Sie fürchtete, kein anderes Thema mehr zu haben, und hatte Sorge, ihr Partner könnte sich irgendwann abwenden, wenn sie nicht „funktioniert“. Kurz gesagt: ihr Leben bestand fast nur noch aus Angst. In der Therapie arbeiteten wir zunächst daran, den Selbstwert wieder aufzubauen. Es ging darum, innere Stärke zurückzugewinnen und Denkflexibilität zu fördern, also Raum zu schaffen zwischen „ganz oder gar nicht“, zwischen Hoffnung und Selbstschutz. Mit der Zeit lernte sie, den Druck loszulassen, sich selbst wieder als eigenständige Person wahrzunehmen und Momente der Leichtigkeit zuzulassen. Sie entschied sich, die Kinderwunschbehandlung für ein Quartal zu pausieren und sich in dieser Zeit ausschließlich auf die Psychotherapie zu konzentrieren. Als sie nach einigen Monaten einen neuen Versuch startete, wurde sie schwanger. Heute hält sie ihren Sohn in den Armen und nannte ihn mir gegenüber scherzhaft ihr „Therapiebaby“. Solche Verläufe lassen
Das stille Leiden der Funktionierenden – wenn Stärke zur Maske wird

Das stille Leiden der Funktionierenden – Wenn Stärke zur Maske wird. – Julia Benner Man sieht es ihnen nicht an: Sie sind zuverlässig, freundlich, hilfsbereit. Sie haben ihr Leben im Griff, erfüllen Erwartungen, sind da, wenn andere sie brauchen. Sie lächeln, auch wenn sie müde sind. Sie hören zu, obwohl sie selbst kaum mehr Kraft haben. Und sie sagen: „Es geht schon“, auch wenn längst nichts mehr geht. Nach außen scheint alles stabil. Arbeit, Beziehungen, Alltag. Alles funktioniert.Doch innerlich hat sich etwas verändert. Die Gedanken kreisen, der Körper ist angespannt, die Freude ist leiser geworden. Nächte sind unruhig, Erholung gelingt kaum noch.Es ist, als wäre das Leben in Bewegung, aber man selbst darin starr geworden. Viele spüren, dass etwas nicht stimmt, können es aber kaum benennen.Es ist keine klassische Depression, keine dramatische Krise. Es ist dieses stille, kaum sichtbare Leiden: das Gefühl, zu funktionieren, statt zu leben. Dieses „Funktionieren“ sieht aus wie Stärke. In Wahrheit ist es oft eine über Jahre gelernte Überlebensstrategie. Sie schützt, aber sie entfremdet.Denn wer zu lange funktioniert, verliert irgendwann das Gespür dafür, was er wirklich braucht. Warum wir funktionieren Viele lernen früh, dass Anpassung Sicherheit bedeutet.„Sei brav“, „sei stark“, „mach keinen Ärger“ – Botschaften, die sich tief ins Nervensystem einprägen. Wer spürt, dass Liebe und Anerkennung an Leistung oder Anpassung geknüpft sind, entwickelt ein feines Radar dafür, was andere erwarten und blendet eigene Bedürfnisse zunehmend aus. Im Erwachsenenleben wird dieses Muster oft belohnt: Engagement, Belastbarkeit, Selbstkontrolle. Doch was nach außen nach Stabilität aussieht, ist innerlich häufig Spannung. Das Nervensystem bleibt im Dauer-Funktionsmodus , eine Art chronische Alarmbereitschaft, die Erschöpfung im Hintergrund erzeugt. Studien zeigen: Rund 60 % der berufstätigen Deutschen geben an, regelmäßig das Gefühl zu haben, „nur noch zu funktionieren“ (TK-Stressstudie 2024). Bei den 30- bis 49-Jährigen, der Lebensphase maximaler Mehrfachbelastung, sind es sogar fast 70 %. Gleichzeitig berichten mehr als die Hälfte der Befragten, sie hätten Schwierigkeiten, abzuschalten oder emotionale Erschöpfung rechtzeitig zu erkennen. Dazu kommt der gesellschaftliche Kontext: Leistung ist Währung, Schwäche ein Makel. Wer erschöpft ist, sucht die Schuld meist bei sich selbst. Also wird weitergemacht, nur noch etwas kontrollierter, strukturierter, perfekter. Ein weiterer Grund, warum viele Menschen funktionieren, liegt in der tiefen Angst, die Kontrolle zu verlieren. Kontrolle vermittelt Sicherheit. Wer in einem Umfeld aufgewachsen ist, in dem Stimmungen wechselhaft oder Grenzen unklar waren, hat oft gelernt: Nur wer alles im Griff behält, bleibt sicher. Dieses innere Programm läuft weiter, auch wenn es längst nicht mehr schützt, sondern erschöpft. Und auch innere Überzeugungen leisten ihren dysfunktionalen Beitrag. Gedanken wie „Ich darf keine Schwäche zeigen“ oder „Wenn ich es nicht mache, macht es keiner“ treiben an, selbst dann, wenn der Körper längst nach Pause ruft. Solche Glaubenssätze wirken wie unsichtbare Regler, die das Tempo hochhalten, auch wenn längst kein Ziel mehr sichtbar ist. Chronischer Stress verändert die Reizverarbeitung. Das Gehirn schaltet in ein Muster ständiger Alarmbereitschaft. Ruhe wird dann unbewusst als Bedrohung interpretiert. Das erklärt, warum viele in Pausen innere Unruhe empfinden. Wenn Stärke zur Maske wird Menschen, die „funktionieren“, erkennen sich selten in klassischen Burnout- oder Depressionsbildern wieder. Sie sind zu sehr in Bewegung, zu sehr in Verantwortung. Ihr Schutzmechanismus ist Aktivität. Laut DAK-Gesundheitsreport 2024 ist die Zahl der Arbeitsausfälle durch psychische Erkrankungen in den letzten zehn Jahren um 48 % gestiegen. Besonders häufig: Erschöpfungsdepressionen und Anpassungsstörungen. Krankheitsbilder, die oft lange Zeit unbemerkt bleiben, weil Betroffene äußerlich „noch funktionieren“. Typische Anzeichen sind: Rationalisierung: „Anderen geht es viel schlechter.“ Selbstabwertung: „Ich stelle mich nur an.“ Überanpassung: Bedürfnisse werden zurückgestellt, Konflikte vermieden. Körperliche Signale: Verspannungen, diffuse Schmerzen, Herzklopfen, Erschöpfung – ohne „erklärbaren“ Befund. Das Problem: Die Maske funktioniert auch gegenüber sich selbst. Emotionen werden nicht mehr gespürt, sondern gemanagt. Die innere Stimme, die sagt „mir ist das zu viel“, wird übertönt vom nächsten To-do. Mit der Zeit entsteht eine leise Entfremdung vom eigenen Erleben. Beziehungen werden anstrengender, Nähe fühlt sich überfordernd an, weil sie Authentizität verlangt. Freude wird seltener, weil sie nicht planbar ist. Der Körper zieht irgendwann die Reißleine: Schlaflosigkeit, Infektanfälligkeit, chronische Schmerzen. Laut Robert-Koch-Institut (RKI, Gesundheitsbericht 2023) erlebt etwa jede vierte Frau und jeder sechste Mann in Deutschland im Laufe des Lebens eine depressive Episode, oft nach Jahren der Überlastung oder des inneren „Funktionierens“. Und psychisch?Viele berichten von innerer Leere. Nicht unbedingt Traurigkeit , eher das Fehlen von Lebendigkeit. Ein stilles, unterschwelliges „nichts mehr richtig fühlen können“. Es ist der Preis einer jahrelangen Übersteuerung des Nervensystems und einer zu perfekten Selbstkontrolle. Eine meiner Patientinnen, Mitte dreißig, ist erfolgreich im Beruf und beliebt im Freundeskreis. Niemand würde vermuten, dass sie abends oft erschöpft auf dem Sofa sitzt und sich innerlich leer fühlt.Sie sagt: „Ich funktioniere einfach. Ich lächle, ich arbeite, ich mache Sport, aber ich fühle nichts mehr richtig.“ Im Verlauf der Therapie wurde deutlich, wie früh sie gelernt hatte, stark zu sein. Sie wollte nie zur Last fallen, immer Leistung bringen, immer Kontrolle behalten.Dieses Muster hatte sie weit gebracht,beruflich und sozial. Aber innerlich war es still geworden. Für sie begann Heilung in dem Moment, in dem sie nicht mehr versuchte, besser zu funktionieren. Sie erlaubte sich, zu fühlen. Zuerst kam Erschöpfung. Dann Unsicherheit. Und schließlich etwas, das lange keinen Platz hatte: echtes Erleben! Der Weg zurück zu sich selbst Heilung beginnt meist nicht mit großen Schritten, sondern mit Erlaubnis: Der Erlaubnis, nicht immer zu funktionieren. Der Erlaubnis, Pausen zuzulassen, Grenzen zu setzen, Hilfe anzunehmen. Psychotherapeutisch bedeutet das: Den Funktionsmodus zu verstehen, statt ihn zu verurteilen.Er war einmal notwendig. Aber er ist nicht mehr zeitgemäß. In der Arbeit mit Patient:innen und Klient:innen geht es darum, emotionale Wahrnehmung wieder zu aktivieren, alte Glaubenssätze („ich muss stark sein“) zu überprüfen und Körperempfindungen als Signale statt als Störung zu begreifen. Erholung ist kein Luxus. Sie ist Voraussetzung dafür, dass das Leben wieder spürbar wird.Das bestätigen auch neurobiologische Studien: Schon 20 Minuten bewusster Entlastung pro Tag (z. B. über Atemübungen oder achtsame Bewegung) senken messbar die Cortisolspiegel und verbessern Emotionsregulation und Schlafqualität (Hölzel et al., Harvard 2023). Warum Entlastung nicht Leistungsabfall bedeutet Viele Menschen fürchten, dass das Innehalten
Saisonale Depression

Wenn die Tage kürzer werden: Herbst, Winter und unsere Stimmung – Julia Benner Im Sommer hatte ich in meinem Blog schon über das Thema Sommerdepression geschrieben – ein Phänomen, das vielen gar nicht bekannt ist, weil eher die dunkle Jahreszeit mit Stimmungsschwankungen verbunden wird. Doch genau das macht die Auseinandersetzung mit Saisonalität und Psyche so spannend: Unser Wohlbefinden ist enger mit Jahreszeiten, Licht und biologischen Rhythmen verwoben, als wir oft denken. Warum die dunkle Jahreszeit auf die Stimmung schlägt Der Herbst bringt mit seinen Farben und Spaziergängen zwar eine gewisse Gemütlichkeit, gleichzeitig verändert sich aber auch unser Biorhythmus spürbar: Weniger Tageslicht: Mit den kürzeren Tagen sinkt die Lichtintensität. Das beeinflusst die Ausschüttung von Melatonin (unserem „Schlafhormon“) und die Regulation von Serotonin, das eng mit Stimmungslage und Wohlbefinden verknüpft ist. Vitamin-D-Mangel: In Deutschland reicht die Sonneneinstrahlung ab Oktober kaum mehr aus, um ausreichend Vitamin D zu bilden. Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen niedrigen Vitamin-D-Spiegeln und depressiven Symptomen (z. B. Anglin et al., 2013, British Journal of Psychiatry). Zirkadiane Rhythmik: Unser innerer Taktgeber reagiert auf Licht. Wenn dieser Rhythmus „verstimmt“ ist, erleben wir häufiger Müdigkeit, Reizbarkeit oder Antriebslosigkeit. Die bekannteste Form davon ist die saisonale affektive Störung (SAD), oft auch Winterdepression genannt. Schätzungen zufolge sind in Nordeuropa etwa 2–5 % der Bevölkerung betroffen, während bis zu 20 % eine abgeschwächte Form – den sogenannten „Winterblues“ – kennen (Lam & Levitan, 2000, American Journal of Psychiatry). Psychologische Dimension : Warum wir uns anders fühlen Neben den biologischen Prozessen spielen auch psychologische Faktoren eine Rolle: Veränderung des sozialen Rhythmus: Im Sommer sind wir mehr draußen, aktiver und sozial eingebunden. Im Herbst ziehen wir uns eher zurück. Das kann Geborgenheit schaffen – aber auch Einsamkeit verstärken. Kognitive Muster: Studien zeigen, dass Menschen im Winter eher zu Grübeln und pessimistischen Gedanken neigen (Rohan et al., 2009). Das liegt u. a. daran, dass weniger positive Erlebnisse (z. B. Sonne, Bewegung draußen) als Gegengewicht verfügbar sind. Symbolik der Jahreszeit: Herbst steht für Abschied, Vergänglichkeit, „Verblühen“. Diese Symbolik kann bei manchen Menschen unbewusst Traurigkeit aktivieren. Praktische Strategien: Was helfen kann Die gute Nachricht: Es gibt viele Möglichkeiten, den eigenen Rhythmus zu stabilisieren und aktiv Einfluss auf die Stimmung zu nehmen. 1. Lichttherapie Klinisch bewährt ist die Behandlung mit einer Lichttherapielampe (10.000 Lux, morgens 20–30 Minuten). Studien belegen eine Wirksamkeit, die vergleichbar mit Antidepressiva sein kann (Lam et al., 2006). Auch im Alltag hilft es, so viel Tageslicht wie möglich zu tanken – Spaziergänge am Vormittag sind besonders effektiv. 2. Bewegung Regelmäßige körperliche Aktivität hebt nachweislich die Stimmung und wirkt antidepressiv (Schuch et al., 2018, American Journal of Psychiatry). Besonders hilfreich: Bewegung im Freien, auch bei grauem Wetter. 3.Struktur & Routinen Der Herbst lädt zu Rückzug ein, gleichzeitig tut es der Psyche gut, verbindliche Routinen zu haben: Feste Aufstehzeiten, Essenszeiten, kleine Rituale. Achtsamkeits- und Atemübungen helfen, den inneren Fokus zu stärken. 4.Ernährung & Vitamin D Viele Betroffene profitieren von einer ärztlich begleiteten Vitamin-D-Supplementierung. Eine ausgewogene, ballaststoffreiche Ernährung stabilisiert den Blutzucker und wirkt sich positiv auf Stimmung und Energielevel aus. 5.Soziale Kontakte bewusst pflegen Dunkelheit und Kälte führen leicht zu Rückzug. Aktiv geplante Treffen mit Freund:innen oder Familie wirken vorbeugend gegen Einsamkeit. Auch kleine Gesten – ein Telefonat, ein gemeinsamer Spaziergang – können Schutzfaktoren sein. 6.Professionelle Unterstützung suchen Wenn die Niedergeschlagenheit über Wochen anhält, der Antrieb stark reduziert ist oder Suizidgedanken auftreten, ist es wichtig, sich professionelle Hilfe zu holen. Psychotherapie kann dabei unterstützen, Muster zu erkennen und neue Bewältigungsstrategien aufzubauen. Ein persönlicher Gedanke In meiner Arbeit mit Patient:innen sehe ich jedes Jahr, wie unterschiedlich wir auf die Jahreszeiten reagieren. Während manche im Sommer durch die Hitze und die ständige Erwartung von Aktivität unter Druck geraten – wie ich es bereits im Artikel zur Sommerdepression beschrieben habe – spüren andere im Herbst und Winter den Rückzug und die Dunkelheit besonders stark. Spannend ist: Beide Phänomene haben eine gemeinsame Basis, nämlich die Empfindlichkeit unseres Körpers und unserer Psyche für äußere Reize wie Licht, Temperatur und soziale Rhythmen. Gerade diese Sensibilität zeigt aber auch, dass es hilfreich sein kann, Jahreszeiten bewusster wahrzunehmen und nicht nur als „normalen Hintergrund“ zu sehen. Statt gegen den Herbstblues anzukämpfen, kann es heilsam sein, neue Rituale zu entwickeln, die dieser Jahreszeit entsprechen – sei es ein regelmäßiger Spaziergang im Morgenlicht, das bewusste Einplanen von Pausen oder kleine Routinen, die Wärme und Geborgenheit schaffen. So entsteht eine Balance zwischen Akzeptanz und Aktivität, die langfristig Resilienz fördert. In meiner Praxis erlebe ich jedes Jahr, dass die dunkle Jahreszeit Menschen besonders fordert. Gleichzeitig sehe ich auch, dass der Herbst eine Chance für Entschleunigung sein kann: Sich bewusst einzurichten, kleine Inseln der Freude zu schaffen – sei es ein Abend mit Kerzen, ein Spaziergang durch buntes Laub oder ein neues Ritual der Selbstfürsorge. Während der Sommer uns oft nach außen zieht, lädt der Winter dazu ein, nach innen zu schauen. Manchmal entsteht daraus nicht nur Stabilität, sondern auch eine Form von innerem Wachstum. 👉 Wenn du merkst, dass dich die dunkle Jahreszeit stärker belastet, als du es allein bewältigen kannst, melde dich gerne für ein Erstgespräch in meiner Praxis Redemoment in Hamburg. Gemeinsam können wir herausfinden, was dir hilft, deine Balance in dieser Jahreszeit zurückzugewinnen.
Therapieablauf – was viele Patient:innen nicht wissen

Therapieablauf – Was viele Patient:innen nicht wissen – Julia Benner Wer erstmals eine Psychotherapie beginnt, weiß oft nicht genau, wie der Ablauf eigentlich aussieht. Viele stellen sich vor, dass die Behandlung nach dem ersten Gespräch sofort startet – in der Realität gibt es jedoch klare Strukturen und gesetzlich geregelte Schritte. Dieser Beitrag gibt Ihnen einen Überblick, damit Sie wissen, was auf Sie zukommt. Die Psychotherapeutische Sprechstunde Am Anfang steht die Sprechstunde. Hier geht es darum, erste Fragen zu klären: Welche Beschwerden bestehen? Ist eine Psychotherapie sinnvoll? Oder gibt es vielleicht auch andere hilfreiche Angebote?In dieser Phase wird eine erste diagnostische Einschätzung vorgenommen. Sie dient sowohl der Orientierung der Patient:innen als auch der Therapeut:innen. Probatorische Sitzungen Auf die Sprechstunde folgen probatorische Sitzungen. Diese Probesitzungen haben mehrere Funktionen: Symptomatik vertiefen: Die Beschwerden werden genauer erfasst. Diagnostik: Es können standardisierte Testverfahren zum Einsatz kommen. Kennenlernen: Patient:in und Therapeut:in prüfen, ob die Chemie stimmt und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich ist. Wichtig zu wissen: Wenn die „Chemie“ nicht stimmt, können Patient:innen die probatorischen Stunden auch bei einem anderen Behandler wiederholen. Genau dafür sind sie gedacht – um sicherzustellen, dass ein gutes Fundament für die therapeutische Beziehung gelegt wird. Denn diese Beziehung ist einer der entscheidendsten Faktoren für den Therapieerfolg. Die biografische Anamnese Ein wichtiger Teil der probatorischen Phase ist die biografische Anamnese. Hier geht es darum, die persönliche Lebensgeschichte zu erheben. Denn: Unsere Biografie prägt uns – mit unseren Stärken, aber auch mit Erfahrungen, die zu Belastungen führen können.Typische Themen sind: Herkunftsfamilie und Kindheit prägende Lebensereignisse frühere und aktuelle Beziehungen bisherige Bewältigungsstrategien Das Ziel ist, Muster zu erkennen und die individuelle Entwicklung besser zu verstehen. Entscheidung über die Therapieaufnahme Nach Abschluss der probatorischen Phase entscheiden Patient:in und Therapeut:in gemeinsam, ob eine Psychotherapie begonnen werden soll.Wichtige Faktoren sind dabei: Stimmt die persönliche Passung („Chemie“)? Ist eine Therapie inhaltlich sinnvoll und aussichtsreich? Bei privater Krankenversicherung oder Beihilfe kann es Unterschiede geben: Manchmal reicht ein einfaches Formular. In anderen Fällen wird ein anonymisierter Bericht an einen externen Gutachter geschickt. Manche Versicherungen übernehmen die Kosten ohne weitere Formalitäten. Hinweis zu gesetzlich Versicherten Viele gesetzlich Versicherte fragen nach dem sogenannten Kostenerstattungsverfahren. Grundsätzlich wäre es möglich, eine Behandlung in einer Privatpraxis auf diesem Wege abrechnen zu lassen. Allerdings sind die bürokratischen Hürden inzwischen so hoch, dass dies in einer voll ausgelasteten Praxis organisatorisch nicht mehr leistbar ist.Ich biete diese Möglichkeit daher nicht mehr an und verweise auf die 116117 sowie die Kassenärztliche Vereinigung, wo Sie freie Vertragspsychotherapeut:innen in Ihrer Nähe finden können. CAVE: Der Unterschied zwischen Vertrags- und Privatpsychotherapeut:innen liegt nicht in der Qualifikation, sondern einzig darin, ob ein sogenannter Kassensitz erworben wurde oder nicht. Alle approbierten Psychotherapeut:innen, unabhängig von Praxisstatus, haben die gleiche Ausbildung und Fachkompetenz. Kosten und steuerliche Aspekte Die Kosten für Psychotherapie sind in Deutschland umsatzsteuerbefreit, da es sich um eine heilkundliche Tätigkeit handelt (§ 4 Nr. 14 UStG). Wenn Patient:innen die Kosten selbst tragen (z. B. Selbstzahler:innen), können diese im Rahmen der Steuererklärung als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden – ähnlich wie Arztrechnungen. Die Höhe der Honorare ist nicht willkürlich, sondern richtet sich nach der Gebührenordnung für Ärzte und Psychotherapeuten (GOÄ/GOP). Diese Vorgaben sind transparent einsehbar und schaffen für Patient:innen eine klare Orientierung. In meiner Praxis erfolgt die Abrechnung in der Regel quartalsweise, sodass Sie einen übersichtlichen Nachweis über die angefallenen Leistungen erhalten. Davon klar zu unterscheiden ist Coaching: Es handelt sich nicht um eine heilkundliche, sondern um eine beratende Tätigkeit. Deshalb fällt – sofern nicht die Kleinunternehmerregelung greift – 19 % Umsatzsteuer auf das Honorar an. Coaching-Kosten können steuerlich nur dann berücksichtigt werden, wenn ein klarer beruflicher Bezug vorliegt. Dann sind sie als Werbungskosten oder Betriebsausgaben absetzbar. 👉 Genau deshalb ist der Unterschied zwischen Psychotherapie und Coaching wichtig: Die steuerliche Behandlung weicht erheblich voneinander ab. Beginn der eigentlichen Therapie Wenn alle Formalitäten geklärt sind, startet die eigentliche Behandlung. Je nach Bedarf stehen unterschiedliche Umfänge zur Verfügung: Kurzzeittherapie: 24 Sitzungen Langzeittherapie: 60 bis 80 Sitzungen (Ausnahmen für mehr Sitzungen möglich) Die Sitzungen finden in der Regel einmal pro Woche statt. Fazit Der Weg in eine Psychotherapie ist klar strukturiert – von der Sprechstunde über die probatorischen Sitzungen bis zur eigentlichen Behandlung. Viele Patient:innen sind überrascht, wie wichtig die erste Phase für Diagnostik, Anamnese und das gegenseitige Kennenlernen ist.Und: Niemand muss nach den ersten Terminen „festgelegt“ sein. Probatorische Sitzungen können auch bei einem anderen Behandler in Anspruch genommen werden. Entscheidend ist, dass Vertrauen, Offenheit und eine gute Zusammenarbeit möglich sind. Nur so kann Psychotherapie nachhaltig wirken. Mein Angebot: Sie möchten mehr über den Ablauf einer Psychotherapie erfahren oder sind unsicher, ob eine Behandlung für Sie sinnvoll ist? Vereinbaren Sie gerne ein Erstgespräch in meiner Privatpraxis Redemoment: gemeinsam finden wir den passenden Weg.
Selbstwert in Beziehungen – warum er so wichtig ist

Selbstwert in Beziehungen – Warum er so wichtig ist. – Julia Benner „Bin ich genug?“ Diese kleine Frage schleicht sich in viele Beziehungen – oft unbewusst.Wenn wir uns selbst nicht stabil und wertvoll erleben, spiegelt sich das im Miteinander: Wir zweifeln, suchen Bestätigung, ziehen uns zurück oder geraten in ständige Konflikte. Studien zeigen: Menschen mit höherem Selbstwert erleben ihre Beziehungen meist als zufriedener, stabiler und vertrauensvoller – unabhängig von Alter oder Beziehungsdauer. Das heißt: Selbstwert ist kein „Nice-to-have“, sondern ein zentraler Prädiktor für Beziehungszufriedenheit, Stabilität und Konfliktverlauf. Menschen sind soziale Wesen. Unser Gehirn ist darauf ausgelegt, Zugehörigkeit und Anerkennung wahrzunehmen – und beides speist unseren Selbstwert. Besonders in Partnerschaften kommt dieser Mechanismus stark zum Tragen: Der Partner als Spiegel: Wie wir angesehen, berührt oder angesprochen werden, wirkt direkt auf unser Selbstbild. Bindung & Sicherheit: Aus psychologischer Sicht (Bindungstheorie) hängt unser Selbstwert eng damit zusammen, ob wir uns als „sicher gehalten“ erleben. Stabile Bindung stärkt das Selbstwertgefühl – instabile oder verletzende Dynamiken können es schwächen. Feedback-Schleifen: Wer unsicher ist, sucht Bestätigung. Das kann den Partner überlasten und genau die Distanz erzeugen, vor der man sich fürchtet – ein Teufelskreis, der den Selbstwert weiter drückt. Ressource oder Risiko: Eine gute Beziehung wirkt wie ein Schutzfaktor gegen Stress und psychische Belastung. Eine konfliktreiche Beziehung dagegen erhöht das Risiko für Ängste oder depressive Symptome. Studien zeigen, dass Selbstwert und Beziehungszufriedenheit sich gegenseitig beeinflussen. Aber langfristig ist es meist der Selbstwert, der vorgibt, wie stabil und glücklich eine Partnerschaft erlebt wird. Wie Selbstwert Beziehungen beeinflusst: Nähe & Distanz: Wer an sich zweifelt, hat oft Angst vor Ablehnung – und klammert oder zieht sich zurück. Demand–Withdraw-Muster (eine:r drängt, andere:r weicht aus) – robust mit schlechteren Outcomes assoziiert. Eifersucht, ständiges „Reassurance-Seeking“ → kurzfristige Beruhigung, langfristig Erschöpfung beider Seiten. (Selbstwert/Bindungsangst) Konflikte: Selbstwertunsicherheit kann dazu führen, dass neutrale Bemerkungen als Kritik erlebt werden. Paare landen dann schnell in Vorwurf–Rückzug-Mustern. Körper & Selbstbild: Unzufriedenheit mit sich selbst wirkt sich auch auf Intimität aus. Trauma/Vertrauensbruch (Affären, digitale Grenzverletzungen): senkt Selbstwert und aktiviert Bindungsunsicherheit. Wenn Beziehungen den Selbstwert schwächen – toxische Dynamiken Nicht jede Partnerschaft stärkt. Manche Beziehungen entwickeln Muster, die den Selbstwert Schritt für Schritt zerstören , sogenannte toxische Dynamiken. Dazu gehören: Abwertung und Kritik: Ständige Vorwürfe („Du bist zu empfindlich“, „Mit dir kann man nichts anfangen“) lassen Selbstzweifel wachsen. Kontrolle und Abhängigkeit: Ein Partner bestimmt über Kontakte, Geld oder Freizeit – das Gefühl von Eigenständigkeit geht verloren. Gaslighting: Die eigene Wahrnehmung wird systematisch in Frage gestellt („Das bildest du dir nur ein“). Betroffene verlieren das Vertrauen in ihr Urteil. Liebesentzug: Zuneigung wird entzogen, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden – Liebe fühlt sich plötzlich an wie eine Belohnung statt wie eine Konstante. Psychologisch bedeuten solche Dynamiken eine dauerhafte Untergrabung des Selbstwertgefühls. Betroffene entwickeln häufiger: depressive Symptome, Angststörungen, psychosomatische Beschwerden (z. B. Schlafstörungen, Magenprobleme), oder ein Gefühl innerer Leere und Identitätsverlust. ! Wichtig ist: Niedriger Selbstwert ist hier nicht „persönliches Versagen“, sondern eine Folge wiederholter Entwertung. Therapie kann helfen, diesen Kreislauf zu erkennen, Grenzen zu setzen und den eigenen Selbstwert Schritt für Schritt neu aufzubauen ! Was Paar-und Einzeltherapie leisten kann: In der Paartherapie Erkennen und Unterbrechen von Mustern: Paare lernen, wieder in den Dialog statt in Vorwurf oder Rückzug zu gehen. Sichere Bindung stärken: Gefühle werden klarer ausgedrückt, Bedürfnisse benannt und besser gehört. Neue Erfahrungen machen: Statt in alten Schleifen zu stecken, erleben Partner, dass Nähe und Streit auch ohne Abwertung möglich sind. In der Einzeltherapie Selbstwert stabilisieren: Gedankenmuster („Ich bin nicht gut genug“) werden hinterfragt und neu bewertet. Selbstmitgefühl fördern: Wer lernt, sich freundlicher zu begegnen, braucht weniger ständige Bestätigung von außen. Eigene Bedürfnisse klarer spüren und kommunizieren. Fazit Ein stabiler Selbstwert ist wie das Fundament eines Hauses: Er macht eine Beziehung tragfähig. Wenn er brüchig ist, zeigen sich Risse – Misstrauen, Streit oder Rückzug. Die gute Nachricht: Selbstwert lässt sich stärken, Muster lassen sich verändern. Paar- und Psychotherapie bieten hier wirksame Wege : wissenschaftlich fundiert und praktisch erfahrbar. Mein Angebot: Möchten Sie Ihren Selbstwert stärken und Ihre Beziehung wieder auf ein stabiles Fundament stellen?In meiner Praxis Redemoment in Hamburg biete ich Verhaltenstherapie, Paartherapie und individuelles Coaching an. Gemeinsam entwickeln wir wirksame Strategien, um destruktive Muster zu durchbrechen, mehr Sicherheit im Miteinander zu erleben und Ihr Selbstwertgefühl nachhaltig zu stabilisieren –> für mehr Klarheit, Verbundenheit und Lebensqualität.
Mental Load 2.0 – Ursachen, Folgen und Tipps zur Reduzierung

Mental Load 2.0: Unsichtbare Last im Alltag. Ursachen, Folgen & Tipps zur Reduzierung – Julia Benner „Ich habe das Gefühl, ständig an alles denken zu müssen und selbst wenn ich Pause habe, läuft mein Kopf weiter.“ So oder so ähnlich beschreiben viele Patient:innen ihre innere Erschöpfung. Der Begriff Mental Load hat in den letzten Jahren an Popularität gewonnen. Er beschreibt die unsichtbare Denkarbeit, die nötig ist, um Alltag, Beruf und Beziehungen am Laufen zu halten. Doch inzwischen reicht es nicht mehr, nur von Mental Load zu sprechen. Wir befinden uns längst in einer Art Mental Load 2.0: Einer neuen Dimension psychischer Überlastung, die durch Digitalisierung, ständige Krisen und gesellschaftliche Anforderungen geprägt ist. Was ist Mental Load 2.0? Ursprünglich bezog sich Mental Load auf die ungleiche Verteilung von Care-Arbeit in Familien (Daminger, 2019). Studien zeigen, dass Frauen weiterhin einen erheblich höheren Anteil an dieser unsichtbaren Denkarbeit übernehmen , selbst wenn sie erwerbstätig sind (Statistisches Bundesamt, 2023). Heute erweitert sich die Perspektive:eine unsichtbare Last, die fast alle betrifft: Eltern, Alleinlebende, Studierende, Führungskräfte. Arbeitswelt im Dauerstress: Laut einer Deloitte-Studie (2023) berichten 77 % der Befragten in Deutschland, dass sie durch Krisen und steigende Arbeitsanforderungen psychisch belastet sind. Digitale Dauererreichbarkeit: WhatsApp-Gruppen, Slack-Nachrichten, News-Alerts – Pausen werden seltener. Untersuchungen belegen, dass ständige Erreichbarkeit zu Schlafproblemen, Stress und reduzierter Erholung führt (Kuhnle et al., 2022). Selbstoptimierungsdruck: Ernährung, Fitness, Achtsamkeit, Altersvorsorge – das „perfekte Leben“ wird zur To-Do-Liste. Eine Studie des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB, 2022) zeigt, dass besonders junge Erwachsene den Anspruch empfinden, Beruf, Fitness, Ernährung und soziale Kontakte gleichzeitig „perfekt“ zu managen. Social Media-Effekte: Laut einer Meta-Analyse (Marengo et al., 2021) verstärken soziale Netzwerke Gefühle von Vergleich, Unzulänglichkeit und psychischem Druck. Psychologische Folgen von Mental Lord Die Folgen von Mental Load 2.0 sind wissenschaftlich gut dokumentiert: Erschöpfung & Burnout: Die WHO stuft Burnout seit 2019 als arbeitsbezogenes Phänomen ein. Dauerhafte kognitive Überlastung gilt als zentraler Risikofaktor (WHO, ICD-11). Konzentrationsprobleme: Neurowissenschaftliche Studien zeigen, dass Multitasking die Arbeitsleistung reduziert und die Fehlerquote erhöht (American Psychological Association, 2020). Schlafstörungen: Laut der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung (DGSM, 2022) leiden rund 30 % der Erwachsenen unter Ein- oder Durchschlafproblemen, oft durch anhaltendes Grübeln. Beziehungsprobleme: Studien zur Partnerschaftsbelastung (Offer, 2021) zeigen, dass unausgesprochene Aufgabenverteilungen die Beziehungszufriedenheit langfristig mindern. Strategien gegen Mental Load 2.0 Externe Struktur statt innerer Daueralarm– Kognitive Entlastung durch To-Do-Listen, Kalender-Apps oder analoge Systeme („Getting Things Done“-Ansatz, Allen, 2001). Radikale Priorisierung– Eisenhower-Matrix oder Kanban-Methoden helfen, Aufgaben realistisch zu bewerten. Aufgabenteilung bewusst einfordern– Sozialpsychologische Studien zeigen, dass explizite Kommunikation über Erwartungen Konflikte reduziert (Bianchi & Milkie, 2010). Digitale Grenzen setzen– „Digital Detox“-Interventionen zeigen positive Effekte auf Stresslevel und Schlafqualität (Labrague, 2021). Selbstfürsorge ohne Selbstoptimierungsdruck– Positive Psychologie betont: Erholung und Genuss steigern Resilienz (Seligman, 2011). Psychotherapie und Coaching als Unterstützung In meiner Praxis erlebe ich täglich, wie entlastend es ist, die unsichtbare Last sichtbar zu machen. In der Verhaltenstherapie arbeiten wir u. a. mit: Gedanken- und Aufgaben-Tracking, um Muster zu erkennen. Kognitiver Umstrukturierung, um überhöhte Verantwortungsgefühle zu hinterfragen. Achtsamkeitstraining (nach Kabat-Zinn), das nachweislich Stress reduziert (Goldberg et al., 2022). Kommunikationstraining, um Grenzen in Partnerschaft und Beruf klarer zu setzen. Im Coaching – insbesondere für Führungskräfte und Menschen in verantwortungsvollen Rollen – liegt der Fokus auf Resilienz, Delegation und Priorisierung, um leistungsfähig und gesund zu bleiben. Fazit Mental Load 2.0 ist mehr als ein Modewort. Es beschreibt eine reale psychische Belastung, die in aktuellen Studien klar belegt ist. Wer die Last ignoriert, riskiert langfristig seine Gesundheit. Der erste Schritt ist, die unsichtbare Arbeit sichtbar zu machen und dann Strategien zu entwickeln, die Verantwortung, Struktur und Selbstfürsorge in Balance bringen. Mein Angebot: Sie möchten Ihren Mental Load reduzieren? In meiner Praxis Redemoment in Hamburg biete ich Verhaltenstherapie und individuelles Coaching an. Gemeinsam entwickeln wir wirksame Strategien, um Mental Load 2.0 zu begegnen : für mehr Klarheit, Entlastung und Lebensqualität.
Zwischen Swipe und Sehnsucht – Dating in der heutigen Zeit aus psychotherapeutischer Sicht

Zwischen Swipe und Sehnsucht – Dating in der heutigen Zeit aus psychotherapeutischer Sicht – Julia Benner Dating hat sich in den letzten zehn Jahren radikal verändert. Was früher auf Partys, im Café oder im Freundeskreis begann, startet heute oft mit einem Wisch nach rechts. Während Dating-Apps scheinbar unbegrenzte Möglichkeiten bieten, erleben viele Menschen – darunter auch meine Klient:innen in der Hafencity-Praxis – zunehmende Orientierungslosigkeit, Selbstzweifel und emotionale Erschöpfung. Als Psychotherapeutin mit Schwerpunkt auf kognitiver Verhaltenstherapie sehe ich immer wieder, wie sich moderne Beziehungsanbahnung auf das psychische Wohlbefinden auswirkt – positiv wie negativ. In meiner Praxis in der Hamburger Hafencity – wo ich Menschen aus den unterschiedlichsten Lebenswelten begleite, vom beruflich stark Eingebundenen bis zur alleinerziehenden Mutter oder dem frisch getrennten Mittvierziger – zeigt sich immer wieder: Die Art, wie wir heute daten, sagt viel über unsere Beziehung zu uns selbst aus. 1. Die Illusion der Auswahl – zu viel des Guten? Moderne Dating-Plattformen funktionieren nach dem Prinzip der ständigen Verfügbarkeit. Wer heute datet, hat theoretisch Zugang zu Hunderten potenziellen Partner:innen – jederzeit, überall. Doch die psychologische Forschung zeigt: Eine zu große Auswahl kann Entscheidungsprozesse lähmen. Der sogenannte choice overload führt dazu, dass wir uns schwerer festlegen, schneller Zweifel entwickeln und Beziehungen häufig gar nicht erst eine echte Chance geben. Zu viele Optionen führen oft nicht zu besseren Entscheidungen, sondern zu mehr Unsicherheit und einem ständigen Gefühl, etwas zu verpassen (FOMO). Ich höre in der Praxis häufig Sätze wie: „Irgendwie weiß ich gar nicht mehr, was ich eigentlich suche.“ Oder: „Ich fange etwas an – aber sobald es verbindlich wird, zweifle ich.“ Hier lohnt es sich, innezuhalten: Geht es wirklich um das Gegenüber – oder um eine tiefere Angst, sich festzulegen oder verletzt zu werden? 2. Das digitale Ich vs. das echte Ich Besonders im Coaching-Bereich erlebe ich, wie sehr das „Dating-Selbst“ sich vom realen Selbst unterscheiden kann. Das eigene Profil ist oft eine kuratierte Version, in der Schwächen, Unsicherheiten und Tiefe kaum Platz haben. Gleichzeitig wird Authentizität erwartet – ein paradoxes Spiel. Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, schildern mir häufig die Angst vor Verletzlichkeit: Wer bin ich hinter dem Erfolg, wenn ich wirklich gesehen werde? Diese Frage stellt sich im Dating-Kontext besonders intensiv – und kann zu Rückzug, Perfektionismus oder innerer Leere führen. 3. Bindungsangst 2.0 – Nähe in einer unverbindlichen Welt Die Verhaltenstherapie kennt das Konzept der sicheren Bindung als zentrale Ressource für psychisches Wohlbefinden. Doch moderne Dating-Kultur ist oft geprägt von Ghosting, Breadcrumbing und Benching – Begriffe, die eine neue Sprache für alte Ängste liefern: Angst vor Nähe, Angst vor Ablehnung, Angst vor dem Alleinsein. In der therapeutischen Arbeit betrachte ich diese Phänomene nicht nur als „Datingprobleme“, sondern als Spiegel tiefer liegender Beziehungsmuster bzw. als Ausdruck von Bindungserfahrungen, die oft in der Kindheit geprägt wurden. Die gute Nachricht: Diese Muster sind veränderbar – wenn wir beginnen, sie bewusst wahrzunehmen. 4. Selbstwert, Einsamkeit und die Suche nach Bedeutung Viele Menschen, die zu mir kommen – ob Ende 20 oder Mitte 50 – erzählen von einer Erschöpfung durch das ständige Daten. Die ständige Anspannung, jemandem gefallen zu wollen, das Enttäuschtwerden, das Gefühl von Austauschbarkeit – all das kann aufs Gemüt schlagen. Dabei zeigt sich immer wieder: Hinter der Dating-Müdigkeit steckt oft ein tiefer Wunsch nach echter Verbindung. Nach gesehen werden, nach Sicherheit, nach Liebe. Und dieser Wunsch ist menschlich – unabhängig von Alter, Geschlecht oder Lebensstil. 5. Dating als Spiegel innerer Arbeit – eine Einladung zur Selbstreflexion Aus psychotherapeutischer Perspektive ist Dating mehr als die Suche nach dem passenden Gegenüber – es ist eine Bühne, auf der sich Beziehungsmuster, Bedürfnisse und Verletzungen zeigen. Eine bewusste Auseinandersetzung mit eigenen Mustern, Grenzen und Wünschen ist daher zentral. Ich ermutige meine Klient:innen, Dating nicht als Prüfung zu sehen, sondern als Lernfeld. Was lerne ich über mich? Welche alten Themen zeigen sich? Wo bin ich zu schnell – oder zu vorsichtig? Und wie kann ich bewusst neue, gesunde Erfahrungen machen? Fazit: Bewusst daten – statt nur wischen Dating in der heutigen Zeit ist herausfordernd – aber auch eine Einladung zur Selbstreflexion. Es fordert uns, bewusster mit uns selbst und anderen in Beziehung zu treten. Wer bereit ist, hinter die Kulissen von Profilbildern und Smalltalk zu blicken, findet nicht nur potenzielle Partner:innen, sondern auch tiefe Einblicke in sich selbst und zu innerem Wachstum.Denn am Ende geht es nicht um den perfekten Match – sondern um echte Verbindung. Mit anderen. Und mit sich selbst.
Homeoffice – Chance oder Risiken & Nebenwirkungen?

Homeoffice – Chance oder Risiken & Nebenwirkungen? – Julia Benner Warum Führungskräfte jetzt genauer hinschauen müssen. Die Pandemie hat das Homeoffice salonfähig gemacht – doch inzwischen ist es keine Übergangslösung mehr, sondern fester Bestandteil unserer Arbeitskultur. Was zunächst wie eine Win-Win-Situation klang, bringt zunehmend differenzierte Erkenntnisse ans Licht: Während manche Mitarbeitende im Homeoffice aufblühen, verlieren andere an Fokus, Engagement und Leistung. Was steckt dahinter? Und was bedeutet das für moderne Führung? Zwischen Freiheit und Verantwortung: Was Homeoffice wirklich mit uns macht Zahlreiche Studien haben sich in den letzten Jahren mit den Auswirkungen von Homeoffice beschäftigt – mit teils widersprüchlichen Ergebnissen: Was diese Diskrepanz verdeutlicht: Homeoffice wirkt wie ein Verstärker für individuelle Persönlichkeitsmerkmale. Wer gut strukturiert, diszipliniert und eigenverantwortlich arbeitet, profitiert. Wer hingegen stark auf äußere Struktur, Kontrolle oder soziale Dynamik angewiesen ist, gerät schnell ins Hintertreffen. Persönlichkeitsmerkmale als Schlüsselfaktor Ob Mitarbeitende im Homeoffice produktiv sind oder nicht, hängt wesentlich von ihren Persönlichkeitsmerkmalen ab – insbesondere: Das bedeutet: Homeoffice funktioniert nicht für alle gleich gut. Und genau hier beginnt die Führungsarbeit. Führung in der Distanz: Zwischen Kontrolle und Vertrauen Homeoffice verlangt von Führungskräften ein neues Führungsverständnis. Klassisches Mikromanagement funktioniert hier nicht mehr – gefragt ist vertrauensbasierte, zielorientierte Führung, die individuelle Stärken erkennt und gezielt fördert. Doch in der Praxis erlebe ich in meinen Coachings immer wieder ähnliche Szenarien:Führungskräfte beklagen schwindendes Engagement, mangelnde Transparenz über Arbeitszeiten oder unklare Prioritäten in den Teams. Mitarbeitende hingegen fühlen sich oft alleingelassen, überfordert – oder schlicht zu wenig gesehen. Coaching als strategisches Führungsinstrument Hier setzt mein Coachingangebot an. Ich unterstütze Führungskräfte dabei, die richtigen Führungsstrategien für hybride Arbeitswelten zu entwickeln – unter anderem durch: Denn gute Führung ist im Homeoffice nicht weniger wichtig – sie ist nur weniger sichtbar. Doch genau hier liegt das Potenzial: Wenn Führungskräfte ihre Mitarbeitenden als Individuen wahrnehmen und stärken, können sie die Chancen des Homeoffice voll ausschöpfen – und Risiken gezielt minimieren. Fazit: Kein „One Size Fits All“ Homeoffice ist keine universelle Lösung – und auch keine Gefahr per se. Es ist ein Arbeitsmodell, das individuelle Chancen und Risiken mit sich bringt. Unternehmen und Führungskräfte müssen lernen, nicht nur Strukturen, sondern Menschen zu führen. Denn erst, wenn wir erkennen, welche Persönlichkeitsmerkmale welchen Einfluss auf Leistung und Engagement haben, können wir gezielt unterstützen – und Homeoffice zur echten Erfolgsgeschichte machen. Lust auf mehr Klarheit im Führungsalltag? Dann lade ich Sie herzlich ein, ein Erstgespräch zu buchen.
Longevity beginnt im Kopf: Warum mentale Gesundheit zentral ist
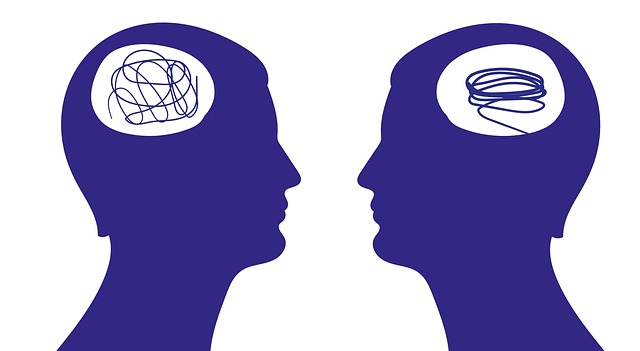
Longevity beginnt im Kopf: Warum mentale Gesundheit zentral ist – Julia Benner Unsere Gesellschaft erlebt einen tiefgreifenden Wandel: Gesundheit ist längst nicht mehr nur die Abwesenheit von Krankheit. Sie ist zum Symbol eines gelungenen Lebens geworden – ein Ideal, das in unserer Gesellschaft zunehmend mit Selbstoptimierung, Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit verknüpft wird. Die sogenannte Longevity-Bewegung fokussiert sich auf das Ziel, nicht nur länger, sondern auch besser zu leben. Dabei lässt sich die zunehmende gesellschaftliche Aufmerksamkeit für das Thema durch mehrere ineinandergreifende Entwicklungen erklären. Einer der zentralen Treiber ist der demografische Wandel: Die Lebenserwartung steigt kontinuierlich, und der Anteil älterer Menschen in der Bevölkerung wächst deutlich. Das führt zu tiefgreifenden Veränderungen in unseren Gesundheitssystemen, in der Arbeitswelt und im sozialen Gefüge – und verlangt nach neuen, ganzheitlichen Konzepten für das Leben im Alter. Parallel dazu ermöglichen medizinische Fortschritte – etwa in der Genom-Editierung oder der personalisierten Medizin – ein immer genaueres Verständnis biologischer Alterungsprozesse. Alter ist heute nicht mehr nur eine chronologische Größe, sondern zunehmend eine biologische Variable, die beeinflussbar scheint. Auch technologische Entwicklungen tragen entscheidend dazu bei, dass Menschen ihre Gesundheit aktiver gestalten können: Wearables, Gesundheits-Apps oder KI-gestützte Diagnostik erlauben eine frühzeitige Erkennung von Risiken und eine individuell zugeschnittene Prävention. Nicht zuletzt verändert sich das gesellschaftliche Gesundheitsbewusstsein ohnehin grundlegend. Immer mehr Menschen möchten nicht nur Krankheiten vermeiden, sondern ihre Gesundheit bewusst fördern und verlängern. Longevity steht somit für einen tiefgreifenden kulturellen Wandel: weg von der rein reaktiven Behandlung hin zu einem präventiven, selbstbestimmten Umgang mit dem eigenen Lebensstil und der eigenen Zukunft. Der Begriff betont ein qualitativ hochwertiges Leben im Alter – mental klar, körperlich fit und sozial integriert. Moderne Forschungsbereiche wie Medizin, Molekularbiologie und Neurowissenschaften zeigen dabei zunehmend Wege auf, Alterungsprozesse zu verlangsamen und chronische Erkrankungen zu vermeiden. Dennoch wird die mentale Gesundheit oft unterschätzt, obwohl sie letztlich entscheidend für ein erfülltes, langes Leben ist. Auch aktuelle Forschungen unterstreichen den engen Zusammenhang zwischen psychischer Gesundheit und Alterungsprozessen: Longevity beginnt im Kopf Langlebigkeit wird oft als Lifestyle-Phänomen inszeniert – mit Superfoods, Eisbädern und Biohacking. Doch wahre Resilienz entsteht nicht an der Oberfläche, sondern im Inneren. Wer lange leben will, muss sich selbst kennen, sich selbst aushalten – und sich selbst verändern können. Wissenschaftliche Studien zeigen klar: mentale Gesundheit ist ein Schlüsselfaktor für Langlebigkeit und Lebensqualität. Chronischer Stress, ungelöste Traumata oder dysfunktionale Denkmuster wirken sich nicht nur auf das emotionale Wohlbefinden aus, sondern erhöhen nachweislich das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Immunschwäche und sogar Demenz. Eine umfassende Studie der Harvard University zeigte, dass die Qualität unserer Beziehungen und unsere emotionale Resilienz ein stärkerer Prädiktor für ein langes, gesundes Leben sind als Ernährung oder Bewegung allein. Und auch die Praxis zeigt: Wer psychisch stabil ist, trifft gesündere Entscheidungen, pflegt stabilere Beziehungen und kann auch mit Alterungsprozessen konstruktiver umgehen. Psychotherapie ist dabei kein reines „Reparaturinstrument“, sondern ein Ort der persönlichen Reifung. Sie ermöglicht, alte Wunden zu heilen, unbewusste Muster zu erkennen und neue innere Handlungsspielräume zu entwickeln – ein essenzieller Beitrag zur seelischen Langlebigkeit. Longevity beginnt also nicht im Fitnessstudio, sondern im Gespräch – in der bewussten Auseinandersetzung mit sich selbst. Psychotherapie und Coaching: ein Ort für reflektierte Gesundheit In meiner Praxis biete ich genau diesen Raum: für tiefergehende Reflexion, emotionale Entlastung und persönliche Entwicklung. Mein Ansatz verbindet wissenschaftlich fundierte Psychotherapie mit einem achtsamen Blick auf gesellschaftliche Trends und individuelle Lebensrealitäten. Ich begleite Menschen, die nicht nur „funktionieren“, sondern leben möchten – bewusst, selbstbestimmt und seelisch gesund. Gerade im Kontext der Longevity-Debatte wird klar: Wer lange leben will, muss lernen, mit sich selbst in guter Beziehung zu stehen. Das bedeutet, auch schmerzhafte Themen anzuschauen, alte Muster zu lösen und das eigene Selbst neu zu gestalten. Ich biete sowohl Psychotherapie bei psychischen Erkrankungen als auch Coaching an, um dich auf deinem individuellen Weg zu unterstützen.Wenn du bereit bist, in deine Gesundheit und Zukunft zu investieren begleite ich dich gern. In einem geschützten Raum, mit fachlicher Tiefe und einem offenen Blick für deine individuelle Lebensgeschichte. Dabei geht es u.a. um Themen wie: Fazit: Gesundheit ganzheitlich denken – mit Psychotherapie als Kompass Gesellschaftliche Trends wie Longevity zeigen: Gesundheit wird zunehmend als ganzheitlicher Zustand verstanden – körperlich und seelisch. Doch in der Realität bleibt die Psyche oft weiterhin der blinde Fleck im Gesundheitsdiskurs. Dabei ist sie nicht nur ein Mitspieler, sondern häufig die heimliche Regisseurin unseres Wohlbefindens. Psychotherapie ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Ausdruck von Weitsicht und Selbstfürsorge. Sie ermöglicht es, in einer Welt voller Anforderungen innerlich klar, stabil und lebendig zu bleiben – auch und gerade mit Blick auf ein langes Leben. Quellen:
Die Wechselwirkung von Stimmung und Leistungsfähigkeit: Ein wissenschaftlich fundierter Blick auf Selbstwert und Lebenszufriedenheit

Die Wechselwirkung von Stimmung und Leistungsfähigkeit: Ein wissenschaftlich fundierter Blick auf Selbstwert und Lebenszufriedenheit – Julia Benner Unsere psychische Verfassung beeinflusst in erheblichem Maße unsere kognitive Leistungsfähigkeit und unser allgemeines Wohlbefinden. Forschungen aus der Neuropsychologie zeigen, dass positive Emotionen nicht nur das Wohlbefinden steigern, sondern auch die kognitive Leistungsfähigkeit und Problemlösefähigkeiten verbessern (Fredrickson, 2001). Gleichzeitig kann ein instabiles Selbstwertgefühl zu Stimmungsschwankungen führen, die sich wiederum negativ auf die Motivation und das Durchhaltevermögen auswirken. Ebenso hat sich gezeigt, dass eine dauerhaft gedrückte Stimmung mit einer erhöhten Cortisolausschüttung korreliert, was langfristig zu kognitiven Defiziten und einer verringerten Stressresistenz führen kann (McEwen, 2007). Der Einfluss der Stimmung auf die Leistungsfähigkeit Die Forschung belegt, dass unsere Stimmung maßgeblich bestimmt, wie effektiv wir arbeiten und wie kreativ wir Probleme lösen. Fredrickson & Branigan (2005) fanden heraus, dass positive Emotionen die kognitive Flexibilität fördern und die Verarbeitungskapazität des Gehirns erweitern. Dies zeigt sich insbesondere in Berufen, die ein hohes Maß an Kreativität und Entscheidungsfindung erfordern. Negative Emotionen hingegen können den Fokus verengen und zu einer rigideren Informationsverarbeitung führen (Bolte et al., 2003). Dies kann kurzfristig nützlich sein – etwa bei der Lösung klar definierter, analytischer Aufgaben – langfristig jedoch die Adaptivität und Innovationskraft einschränken. Selbstwert als Schlüsselvariable für Lebenszufriedenheit Ein weiteres zentrales Element ist der Selbstwert, der stark mit sowohl emotionalem Wohlbefinden als auch Leistungsfähigkeit verknüpft ist. Studien zeigen, dass Menschen mit einem stabilen Selbstwert weniger anfällig für stressbedingte Leistungseinbrüche sind (Orth et al., 2010), resistenter gegenüber Misserfolgen und Herausforderungen konstruktiver bewältigen können. Häufig wird Selbstwert mit beruflichem Erfolg assoziiert, doch diese Verknüpfung birgt Risiken.Wie Selbstwert definiert wird, spielt hierbei eine zentrale Rolle. Studien zeigen, dass eine bedingte Selbstwertregulation – also ein Selbstwert, der primär von externen Erfolgen wie beruflichen Leistungen abhängt – zu einer erhöhten Anfälligkeit für Stress, Angst und depressive Symptome führen kann (Crocker & Park, 2004). Im Gegensatz dazu sind Personen mit einem sogenannten kontingenten Selbstwertgefühl weniger stark von externen Faktoren abhängig. Sie weisen eine gesündere Emotionsregulation auf und zeigen eine größere psychische Widerstandsfähigkeit. Deci und Ryan (2000) postulieren in ihrer Selbstbestimmungstheorie, dass ein stabiler Selbstwert aus intrinsischer Motivation und authentischer Selbstakzeptanz resultiert, während extrinsisch motivierte Leistungsziele oft zu Unsicherheit und einem instabilen Selbstwert führen. Langzeitstudien bestätigen, dass Selbstwert nicht nur eine Konsequenz, sondern auch eine Ursache von Erfolg ist: Eine Metaanalyse von Orth & Robins (2014) zeigt, dass ein gesunder Selbstwert langfristig zu besseren akademischen und beruflichen Leistungen führt, während umgekehrt beruflicher Erfolg nur einen geringen Einfluss auf die langfristige Stabilität des Selbstwertgefühls hat. Die Wechselwirkung zwischen Selbstwert und Stimmung: Ein Risikofaktor für depressive Symptome Ein weiterer besonders bedeutsamer Aspekt ist die gegenseitige Beeinflussung von Selbstwert und Stimmung. Forschungsergebnisse zeigen, dass ein niedriger Selbstwert nicht nur eine Folge depressiver Verstimmungen sein kann, sondern oft auch als Ursache für die Entstehung von Depressionen fungiert. Die Vulnerabilitätsmodell-Hypothese (Orth et al., 2008) beschreibt, dass Menschen mit einem geringen Selbstwert ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung depressiver Symptome haben, da sie negative Erfahrungen stärker auf sich selbst beziehen und sich in negativen Gedankenmustern verfangen. Eine Langzeitstudie von Sowislo & Orth (2013) bestätigt, dass ein niedriger Selbstwert langfristig depressive Symptome vorhersagt – und nicht umgekehrt. Das bedeutet, dass ein instabiler oder niedrig ausgeprägter Selbstwert eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Depressionen spielt. Gleichzeitig können depressive Zustände den Selbstwert weiter senken, was einen Teufelskreis aus negativen Gedanken, Antriebslosigkeit und Selbstzweifeln entstehen lässt. Dieser Mechanismus hat erhebliche Konsequenzen für die psychische Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Menschen mit einer negativen Selbstbewertung neigen dazu, sich selbst strenger zu bewerten und Fehlschläge als persönliche Unzulänglichkeiten zu interpretieren (Beck, 1967). Dies kann zu anhaltender Frustration, Demotivation und letztlich zur Entwicklung depressiver Episoden führen, die nicht nur die Lebensqualität, sondern auch die berufliche und akademische Leistungsfähigkeit weiter erheblich beeinträchtigen. Verhaltenstherapeutische Ansätze zur Förderung von Selbstwert und Leistungsfähigkeit Die Privatpraxis Redemoment setzt auf verhaltenstherapeutische Strategien, um den Klienten zu einem nachhaltig gesunden Selbstwert zu verhelfen. Ein zentrales Konzept dabei ist die kognitive Umstrukturierung, die darauf abzielt, dysfunktionale Gedankenmuster zu identifizieren und durch realistische, selbstförderliche Bewertungen zu ersetzen. Dies basiert auf den Erkenntnissen der Kognitiven Verhaltenstherapie (Beck, 1976), die nachweislich eine hohe Wirksamkeit in der Behandlung von Selbstwertproblemen und stressbedingten Leistungseinbrüchen zeigt. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Entwicklung eines sogenannten „nicht-kontingenten“ Selbstwerts, bei dem Individuen lernen, ihren Wert nicht nur aus ihrer beruflichen oder akademischen Leistung abzuleiten, sondern auch aus persönlichen Stärken, sozialen Beziehungen und sinnstiftenden Tätigkeiten (Kernis, 2003). Dieser Ansatz hilft dabei, die emotionale Abhängigkeit von externen Erfolgen zu reduzieren und somit langfristig zu einer stabileren psychischen Gesundheit beizutragen. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist das Training der Selbstmitgefühlspraxis, welche nachweislich die negativen Effekte eines geringen Selbstwerts abmildern kann. Neff (2011) zeigte, dass Menschen mit hohem Selbstmitgefühl weniger anfällig für Selbstkritik sind und sich schneller von Misserfolgen erholen. Leistung und Ehrgeiz als zentrale, aber nicht alleinige Faktoren für Zufriedenheit Wichtig ist jedoch die Differenzierung: Die Erkenntnisse über Selbstwert und emotionale Stabilität bedeuten nicht, dass Ehrgeiz und Leistungsstreben irrelevant sind. Im Gegenteil: Ein hoher Grad an Zielorientierung ist mit höherer Lebenszufriedenheit und beruflichem Erfolg assoziiert. Allerdings ist entscheidend, dass Ehrgeiz nicht auf einer übermäßigen Abhängigkeit von externer Anerkennung basiert. Die Forschung zeigt, dass intrinsisch motivierte Personen, die ihre Ziele aus eigenem Antrieb verfolgen, langfristig eine größere Zufriedenheit und Resilienz aufweisen als solche, die stark auf externe Belohnungen angewiesen sind (Deci & Ryan, 2000). Fazit: Ein balanciertes Konzept für nachhaltige Leistungsfähigkeit Die wissenschaftlichen Erkenntnisse belegen also, dass eine nachhaltige Leistungsfähigkeit nicht nur von Fleiß und Ehrgeiz abhängt, sondern auch von der Fähigkeit, die eigene Stimmung zu regulieren und einen stabilen Selbstwert zu entwickeln. Da Selbstwert und Stimmung sich gegenseitig beeinflussen, kann eine negative Spirale entstehen, die zu depressiven Symptomen führen kann. Präventive Maßnahmen – wie die Stärkung des Selbstwerts und das Erlernen emotionaler Regulationsstrategien – sind daher essenziell, um langfristig leistungsfähig und psychisch stabil zu bleiben. Es ist nicht das Ziel, Ehrgeiz oder Leistungsorientierung abzuwerten. Vielmehr geht es darum, eine gesunde Balance zwischen ambitioniertem Streben und innerer Zufriedenheit zu finden. Ein ganzheitlicher Ansatz, wie er in meiner Privatpraxis Redemoment verfolgt wird, unterstützt Menschen dabei, ihre Leistungsfähigkeit
